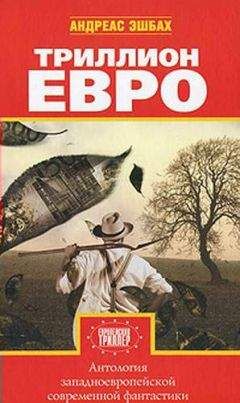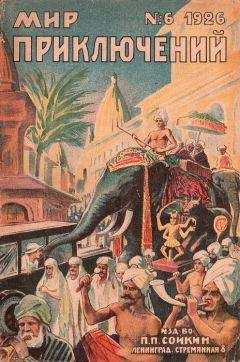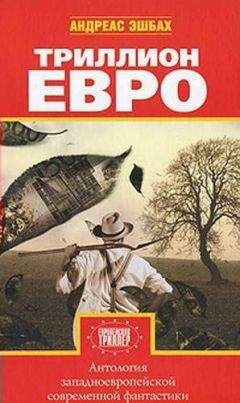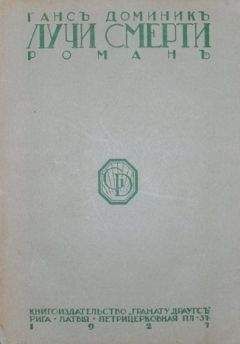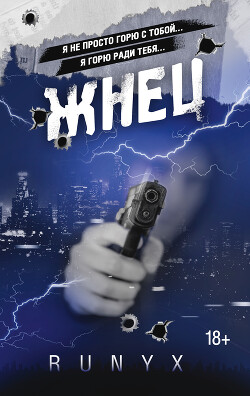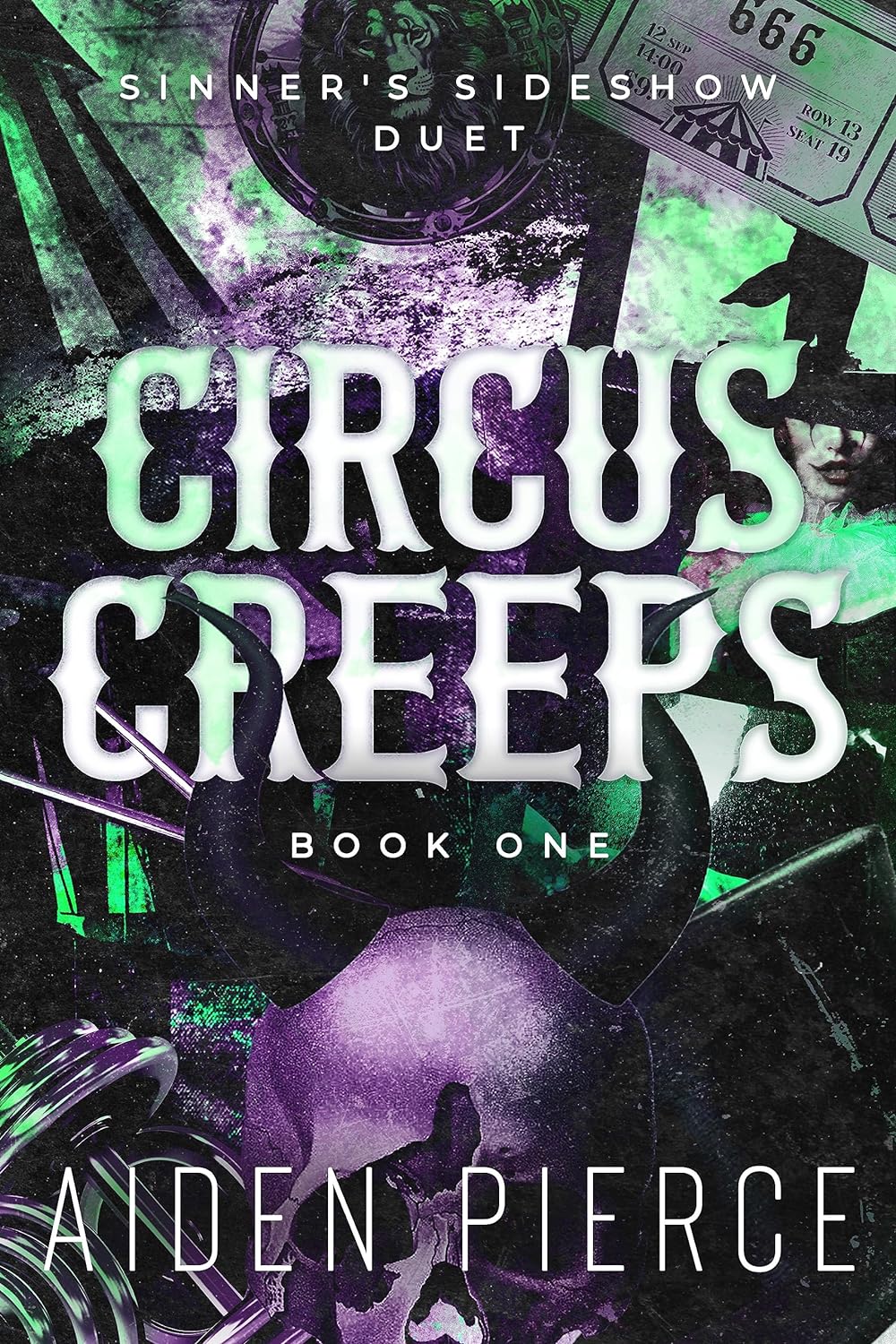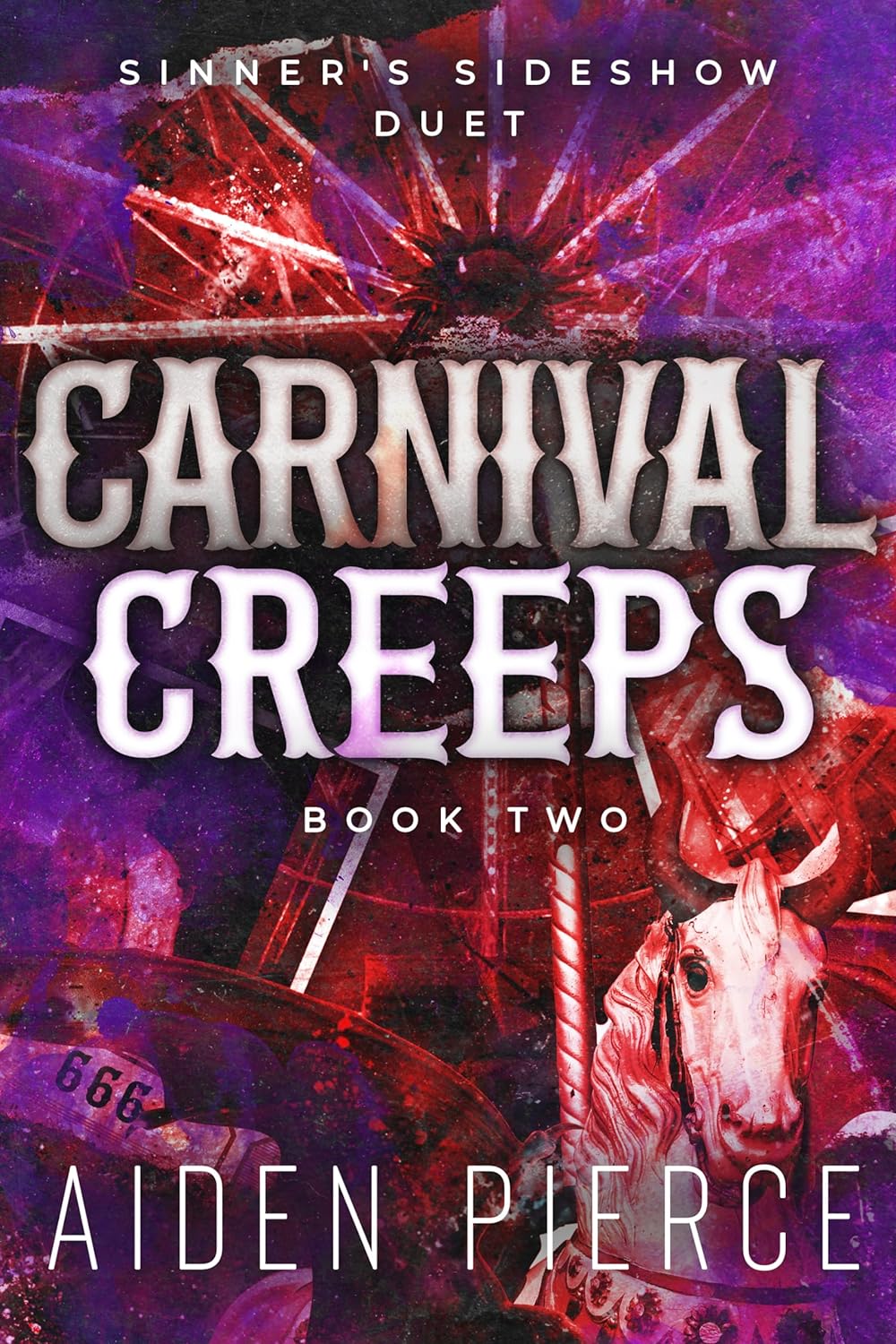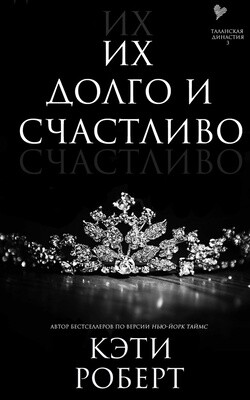Peter Wawerzinek - Rabenliebe

Помощь проекту
Rabenliebe читать книгу онлайн
Es GIBT MOMENTE der Unendlichkeit als den Versuch, das Grenzenlose zu erreichen. Die betroffene Person ist hellwach und hat keine Wahl, sich nicht darauf einzulassen. Es gibt den kurzen Augenblick, in dem alle Erinnerungen angesiedelt sind. Es gibt Erinnerungen, deren Abläufe nicht ausgedacht sein wollen. Es gilt beim Sicherinnern, die nicht bedachte Erinnerung zu beleben, die Nebenarme der vergangenen Zeit zu befahren. Die Unendlichkeit im mathematischen Sinn ist beim Erinnern außer acht zu lassen. Die plötzlich auftretende Form von Erinnerung ist die Begegnung mit dem gefrorenen Zeitzustand. Wir hauchen ein Loch in die vereiste Scheibe und blicken auf das Persönlichste.
UND DANN IST auch diese Zeit vorbei und kommt nie wieder. Sie haben mir nicht gesagt, dass es bald fortgehen wird. Sie sind gekommen und es ging dann fort. Kurzer Abschied. Kein weiteres Wort. Und mit den anderen Kindern haben sie es genauso gehalten. Ich verlasse das Heim. Ich verlasse die beiden Mädchen. Ich bin verlassen. Ich werde nie wieder bei den Mädchen auf dem Zimmer erwachen, die freien Pobacken nicht der beiden Mädchen unter emporgerutschten Nachthemden im Doppel betrachten, auf Apfelsinenhälften blicken, in deren Mitte die zarten Mandelhälften entdecken, niemals wieder so unbescholten aus der Nähe so angesehen, nie wieder dergestalt gefühlsecht nackte Mädchenhintern betrachtet. Eia popeia, was raschelt im Stroh, das sind die lieben Gänschen, die habn keine Schuh, der Schuster hat Leder, kein Leisten dazu, drum gehn die lieben Gänschen und habn keine Schuh. Nie wieder einem Fleisch solch Geruch entweichen erlebt. Nie wieder am Morgen vor solcher Pracht gekniet, die heilige Ewigkeit vor zwei heiligen Betten, in ihnen Engel mit Hinterteilen, die sich im Gleichtakt abwenden und unter den Bettdecken verschwinden. Es ist wie mitten in der Kindheit, die Kindheit abgeschlossen. Ich habe das Kinderheim zu verlassen. Man transportiert mich in einen nächsten Ort, ein anderes Kinderheim gewährt mir Unterkunft. Es ist Sommer. Ich habe drei Wochen Zeit, mich zu gewöhnen. Ich erlerne Schrank- und Bettenbau. Es herrscht Rangordnung unter den Kinderheimkindern. Die Größeren haben das Sagen. Ich liege oft genug hellwach im Bett und habe Angst vor den lauten Pfiffen der Trillerpfeife, die der ehemalige Polizistenerzieher durch den Flur jagt, worauf wir dann hochschrecken und aus dem Bett hinaus auf den Flur springen und Haltung annehmen. Es geht ihm um stete Proben und Vorbereitung fürs Gefecht, wie der Erzieher sagt. Er sieht in unsere Gesichter, schnippt das hängende Kinn vom Brustkorb des Kindes hoch, das im Stehen weiterschläft, und hat seine Freude daran, wie der Kopf nach dem Handstreich zur Seite oder flott nach hinten kickt. Er pickt sich diesen und jenen aus dem angetretenen Grüppchen heraus, der seiner Meinung nach nicht wie für das Gefecht angezogen ist, viel zu schläfrig wirkt, müde mault, gar versucht ist, Gegenrede zu wagen. Der muss dann im Flur auf und ab laufen, kriechen, springen und lange vor der Tür in Reihe stehen und laut das immer gleiche Lied singen, von ihm und Leidensgenossen im Kanon vorgetragen, bis der Kanon sitzt: Ach ich bin so müde, ach ich bin so matt, möchte gerne schlafen gehen und des Morgens früh aufstehn. Wir anderen, wir Davongekommenen liegen auf unseren Rücken im Bett, starren ins Dunkle und finden keinen Schlaf, solange im Flur gesprungen, gesungen und mit der Trillerpfeife gepfiffen wird. Was davon bleibt dir in Erinnerung, fragt mich die immer gleiche gurgelnde Stimme mit spitzem Oberton, wenn ich im Bett liege und die Geschehnisse im Flur aufnehme. Eine bösartige Stimme, die mich bei meinen Ohren packt, es schmerzt, als zöge einer daran. Es ist die Stimme des Busfahrers im geriffelten Unterhemd am Küchentisch der Köchin Frau Blume, der immer nur am Tisch gesessen hat und seine Zeitung aufgeschlagen hielt. Ich sehe ihn wie in einem Horrorstreifen als Schreckensporträt an der Zimmerdecke. Hinter seiner abgegriffenen Zeitung redet er hervor. Immer nur dieser eine Tonfall und diese eine Stimme von hinter dem einen Zeitungsblatt her. Der Ton, der verletzen soll. Die ewige Leier, die jede fällige Antwort strikt in Schranken weist, auf Frage macht, nicht beantwortet werden soll, den Befragten aus tiefer Seele ablehnt. Der Ton, der höhnt und all meine Träume dominiert. Ich träume vom Busfahrer, seiner Stimme, diesem öden Tonfall, der mich von allen Seiten anfällt, mich mit gehässigen Worten bespricht. Schicksal. Watschen. Schläge. Über die Jahre habe ich immer wieder mit dieser Stimme zu schaffen. Sie taucht einfach auf und lacht gehässig, als freue es sie, dass ich von ihr gestört bin, die Nacht aus ist, wenn sie ertönt, ich von dem Alp besetzt bin. So komme ich in die Schule. Das Kinderheim ist ein Schulkinderheim. Wir sind Schulheimkinder oder Heimschulkinder, je nachdem. Ich trage einen dunklen See inmitten meiner Seele; der ist so tief und schwarz und unberührt.
ICH SITZE AM FRÜHSTÜCKSTISCH. Ich fühle den Hunger, der mich oft befallen hat. Ich bin in Gemeinschaft und fühle mich allein. Ich esse schneller als andere Menschen mein Frühstück. Ich muss mich beherrschen, bewusst langsamer speisen. Ich habe mich jeden Tag zu zwingen, nicht gierig in mich hineinzustopfen, nicht zu schlingen, wie zu Zeiten, als wir im Vorbeilaufen zugegriffen und uns genommen haben, wessen wir habhaft werden konnten. Ich erwische mich beim Versuch, drei Scheiben Wurst auf eine Brötchenhälfte zu legen, und lege die dritte Scheibe auf den Wurstteller zurück. Ich mache nicht mehr so große Happen. Ich stürze keinen Liter Milch mehr hinunter. Manchmal, wenn ich weiß, dass ich allein mit mir bin, gefällt es mir, meine Finger in ein Glas mit Bockwurst zu stecken, nach dem Bockwurstzipfel zu greifen, die Bockwurst herauszuziehen, den Kopf nach hinten zu neigen, die Wurst von oben her anzubeißen und aufzuessen. Ich bin in solchen Momenten wieder das Kind unter Kindern im Kinderheim, halte ein Bockwurstglas sicher in meinem Arm, drücke ein Bockwurstglas an mich, behandle ein Bockwurstglas wie eine Schatztruhe, auf dem Beutezug ergattert und in den Keller getragen, aus dem Depot gemopst. Ich greife mir den gebratenen Fisch aus dem Bratfischglas. Ich greife die saure Gurke aus dem Gurkenglas und biege den Kopf nach hinten, die Augen genüsslich geschlossen. Meine heimlichen Angewohnheiten kann ich nicht vollständig entheimen. Ich zuckere meinen Tee, wenn Zucker auf dem Tisch steht. Ich komme ohne Zucker aus, wenn kein Zucker vorhanden ist. Ich werde nicht um Zucker und Sahne für den Kaffee bitten, wenn Zucker und Sahne nicht vorhanden sind. Ich bin nicht gewohnt, dass mir Zucker und Sahne gebracht werden. Ich esse das Brot, das auf dem Tischtuch feilgeboten ausliegt. Mir schmeckt das Brot, das ohne Butter angeboten wird, das nur mit Senf bestrichen ist. Und habe ich gespeist, trage ich mein Geschirr in die Spüle, wasche meine Hände, reinige den Mund, netze die Stirn, den Hals und beide Wangen mit dem Restposten Wasser. Ich schaue in jeden Spiegel, ob alles in Ordnung ist. Denn hinter der Tür steht die Kontrolle, die mich ansieht, und ich halte meine Hände hin, lasse mir in die Ohren sehen. Und sehe mich zurückgeschickt oder zur Gruppe beordert. Nennt es Drill, nennt es Zucht und Ordnung. Es sitzt in mir. Ich ätze es nicht aus. Ich drehe, wenn ich mich unbeobachtet fühle, immer noch meinen Kopf vor dem Spiegel, drehe mich einmal um meine Achse, betrachte meinen Kopf von vorne, im Profil, von hinten, bleibe ungläubig, weiß den Mann an der Gartenpforte noch, der zu mir gesagt hat, am Profil des Gesichtes ist die vergangene Zeit eines Menschen abzulesen. Man kann das Heimkind an mir erkennen. Ich unternehme dagegen nichts.
Wenn ich an die Winter im Heim denke, spüre ich trockene Zentralheizungsluft. Ich suche mir dagegen zu helfen, indem ich mich erhebe, etliche Male zum Wasserhahn gehe, mir den Bauch voll Wasser pumpe, das Gesicht nässe, die Nasenflügel wässere, die Augenbrauen feucht nachziehe, dass die Kühle so lange wie möglich erhalten bleibt. Es hilft nicht, gegen die verfluchte Heizung anzuschreien. Sie ist fest eingestellt und all ihrer Drehknöpfe beraubt. Sie steht unter strenger Bewachung durch den Hausmeister, der jeden Montageversuch entdeckt und den Täter verfolgt.
Der dicke Heinz dreht schnell mal durch, schreit nach Luft, rüttelt am Fenster, öffnet es, ruft in seinem Wahn nach Hilfe, atmet frische Luft. Der dicke Heinz schafft es manches Mal nicht, das Fenster sachgerecht zu öffnen, will einen Stein nehmen, das Fenster zertrümmern, die glasfreien Flanken sprengen, den ganzen Kopf durchs Fensterglas stoßen, um an die geheiligte, frische Luft zu gelangen. Die Erzieher sind da, wenn einer ausrastet. Sie halten ihn, binden ihn, schleifen ihn fort, schaffen ihn in den Raum ohne Fenster und Gitter und ohne Zentralheizungskörper. Je öfter Heinz das ertragen muss, umso rascher findet Heinz sich damit ab, denken sie. Eine Nacht genügt und der dicke Heinz ist heiser, hat sich sprachlos geschrien, an allen vier Wänden ausgetobt, sich beim Kampf gegen den Raum Abschürfungen, Beulen, Flecken geholt. Wie ich die Dinge drehe und wende. Ich bin nicht verhungert, musste nicht Sklavenarbeit verrichten, mich drangsalieren und quälen, misshandeln und zu Tode schleifen lassen. Der Staat ist mein Kummerflügel. Das Heim ist meine Achselhöhle. Ich komme ohne Vater und Mutter aus. Das Heim ist die annehmbare Alternative zur Familie.
Säugling ausgesetzt worden. Jugendliche hatten den Säugling auf einem Parkplatz gefunden. Es war an diesem Sonntag, einem wunderbaren Sommerabend im Allgäuer Urlaubsort Immenstadt. Zwei Brüder (14 und 16) tragen Werbeprospekte aus. In der Nähe des Krankenhauses hören sie kurz vor zehn Uhr ein Wimmern. Sie gehen dem Geräusch nach — und finden im Gebüsch den Säugling, eingewickelt in eine Decke. Die Geschwister nehmen ihn vorsichtig und tragen ihn zur Notaufnahme der Klinik. Die Ärzte schätzen, dass der Bub vor zwei Tagen zu Hause entbunden wurde. Nun ermittelt die Kripo Kempten. Sie fragt: Wer kann Hinweise zu einer hochschwangeren Frau geben, die vor kurzer Zeit entbunden und kein Kind hat? Ein Mann könnte Hinweise geben, den Zeugen nahe des Fundortes sahen: Er ist 20 bis 30 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, schlank, hat kurzes, lockiges Haar, eventuell einen Drei-Tage-Bart und war dunkel gekleidet. Der Säugling von Immenstadt — er ist nun schon das fünfte ausgesetzte Baby innerhalb kürzester Zeit. Im letzten September hörte ein 21-Jähriger im Fürther Stadtpark ebenfalls ein Wimmern in einem Busch und entdeckte einen in eine Decke gewickelten Säugling. Er brachte ihn ins Krankenhaus. Es war ein Mädchen, auch ihm ging es gut. Mitte November dann wurde ein Mädel im Foyer einer Sparkassenfiliale in Hof ausgesetzt. Sensationelles Ergebnis eines DNA-Tests: Das Findelkind hat einen Bruder, der 2001 vor der Sparkasse Plauen ausgesetzt wurde. Ende November 2008 legte eine Frau im oberpfälzischen Velburg ihr Baby vor einer Arztpraxis ab mit dem Zettel: Bitte geben Sie das Kind zum Jugendamt. Das Kind starb an einem Kreislaufzusammenbruch. Heuer im März wurde nahe der Donauklinik Neu-Ulm ein Baby ausgesetzt. Es war bis auf eine leichte Unterkühlung gesund. Und der wohl grauenerregendste Fall: Letztes Jahr im Advent fand Pfarrer Thomas Rein (40) in der Krippe in seiner Kirche in Pöttmes (Kreis Aichach-Friedberg) ein Baby. Die Mutter wurde ermittelt. Sie lebt mittlerweile in ihrer Heimat Rumänien, der Bub, er wurde Christian genannt, lebt in einer Pflegefamilie in Schwaben. Der Bub sieht schlecht und ist teilweise gelähmt. Ob dies daran liegt, dass der Bub in der Kälte ausgesetzt wurde? Das kann laut den Ärzten nicht ausgeschlossen werden.
MEINE FREUNDE IM HEIM hießen Heinz und Tegen. Beide vergucken sich in Mädchen. Heinz beschenkt sie mit Schokolade. Tegen wird von den Mädchen an den Sandkasten gerufen. Er darf sich zu ihnen setzen. Er darf mit ihnen reden. Sie laden ihn zum Kaufmannsladenspiel ein, packen Ware in den Korb, kochen, braten Speisen für sich und ihn. Handeln Preise aus. Tegen kauft sandige Batzen, tut, als äße er Kuchen, reibt sich den Bauch, amüsiert die Mädchen mit Komplimenten. Heinz mag nicht mit den Mädchen Kaufmannsladen spielen. Es ist ihm zu affig. Er möchte den Mädchen Briefe schreiben. Er kann es nicht. Was er sich abringt, ist nichts wert. Ich gebärde mich als Schriftsteller, bin erst Tegens höfischer Briefschreiber, reime schön auf sehn und Haar auf wunderbar, bringe das Wort spielen in Zusammenhang mit fühlen, verhelfe dem sehen zu Klang auf mit dir gehen. Heinz und Tegen müssen mir je nach Umfang und Länge der Liebesbriefe etwas geben. Ich bin glücklich, dass meine Erfindungen gefallen, und fahre eifrig fort. Ich schreibe von schneeweißen Schwänen in Strähnen. Ich nenne die Geschenke nicht Honorar, ich nehme normale Süßigkeiten an, führe ein sorgenfreies, süßes Leben, habe Lutschbonbon so gern wie bittere Schokolade.
Wenn alle Menschen Künstler wären oder Kunst verstünden, wenn sie das reine Gemüt nicht beflecken und im Gewühl des Lebens verängstigen dürften, so wären doch gewiss alle um vieles glücklicher. Dann hätten sie die Freiheit und die Ruhe, die wahrhaftig die größte Seligkeit sind. Johann Ludwig Tieck.
ES IST OSTERN. Zwischen Berg und tiefem, tiefem Tal saßen einst zwei Hasen, fraßen ab das grüne, grüne Gras bis auf den Rasen, als sie sich sattgefressen hattn, setzten sie sich nieder, bis dass der Jäger kam und schoss sie nieder, als sie sich nun aufgerappelt hattn und sich besannen, dass sie noch am Leben warn, liefen sie von dannen. Wir laufen über den Hinterheimplatz, suchen kleine Pappkörbe mit Ostereiern, Schokolade, Bonbons. Die Körbe sehen nicht nur alle gleich aus, sie sind identisch gefüllt. Einzig die hartgekochten, farbigen Hühnereier machen den Unterschied. Ich finde das erste Körbchen flink. Es geht mir zu schnell. Ich stelle das Körbchen wieder ab. Es erfreut ein Mädchen nach mir. Ich sehe mich um. Ich sehe dort ein Körbchen versteckt und da, allesamt nicht mit Freude versteckt. Ich möchte ein blaues Ei in meinem Osterkorb liegen haben, sage ich mir. Ich liebe die Farbe Blau. Der erste Vogel, der mit mir spricht, ist eine Blaumeise. Blau ist der Himmel über dem Meer. Bianca trägt blaue Schuhe. Flecken werden blau, wenn man sich verletzt hat. Es ist in keinem Korb ein blaues Ei zu finden, und es soll aber das blaue Ei gefunden werden, das es geben muss; in einem Körbchen, gut versteckt. Das blaue Ei, das sich nicht leicht finden lassen will, das einzige blaue Ei des Ostertages, das mir gehört, das ich finden muss. Kinder finden weitere Körbchen mit gelben, grünen, roten Eiern darin, nur nicht das angestrebte blaue Ei. Ich verkünde, den Inhalt meines Korbes demjenigen zu schenken, der mir dafür sein hartgekochtes, blaues Ei eintauscht. In den Körbchen der anderen Ostereiersuchkinder, die den Tausch mit mir möchten, finden sich spinatgrünglänzende Eier, Eier in Laubfroschgrün, Kohlweißlinggelb, Rosa, Veilchenviolett, nicht aber in Blau. Ich schlüpfe durch einen Spalt im Zaun zum Heimgelände hinaus, um dort mein Körbchen zu entdecken. Vergeblich, ich kehre nach angestrengter Suche um, man hat mich entdeckt und zurückbefohlen. Ich habe alles auf die Farbe Blau gesetzt und alles verloren. Ich bin der Einzige ohne Korb, was nicht richtig ist, mich traurig stimmt, weil ich die anderen sehe, wie sie mit ihren Körben angeben, und ich weiß, dass man mir kein Extrakörbchen geben wird, gar keins mit einem blauen Hühnerei. Und wie ich meine fixe Idee verfluche und sauer bin auf mich und meine Einfälle, blinkt meinem gesenkten Blick am Kohlenhaufen aus dem Kohlenstaub etwas Blaues entgegen; aus einem Körbchen, das von einem unachtsamen Schuh in den Kohlestaub hineingetreten worden ist. Ich bücke mich, grabe, rette die süßen, bunten Zuckereier, die mit Staub beklebt sind. Das blaue Ei ist zertreten, ein Quetschei mit Staub vermengt. Ich hebe es auf. Mir stehen Tränen in den Augen. Mehr Tränen vor Glück als Tränen vor Wut. Ich trage das zertretene Ei in den Waschraum, lege es auf den Rand des Waschbeckens, wasche die Zuckereier von Kohlenstaub rein. Von Staub befreit, verlieren sie ihre dünnen Zuckerglasuren, dass sie zu kleinen weißen Zuckereiern werden. Ich wische die Farbtropfen vom Waschbeckenrand. Ich reibe die Eier mit Toilettenpapier trocken, stecke sie in die Hosentasche. Das blaue Ei, der Klumpen aus Eierschale, Eiweißstaub, Kohle. Der Tritt hat gesessen. Das Ei ist nicht zu reparieren, so sehr ich mich auch mühe. Ich rette nur Stücke, die sind nicht zu genießen. Ich esse von dem Matsch, was immer davon zu essen geht. Sand knirscht zwischen meinen Zähnen. Die Tränen fließen. Ich kann mich nicht erinnern, je mehr geweint zu haben als in diesem Waschraum.