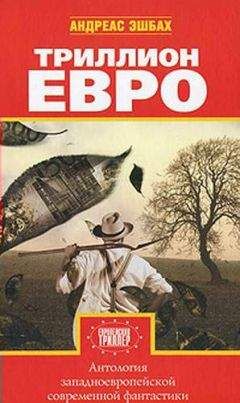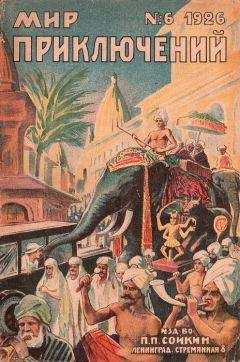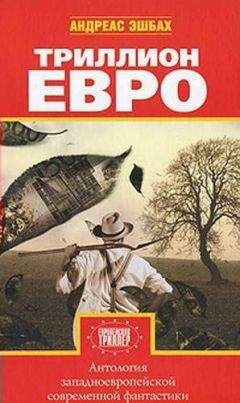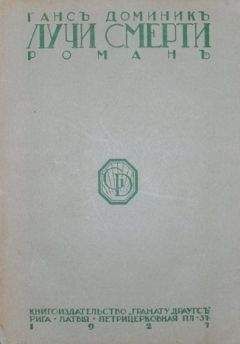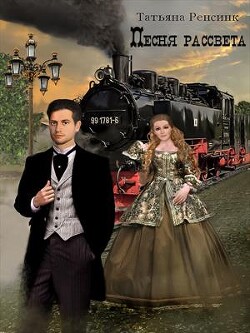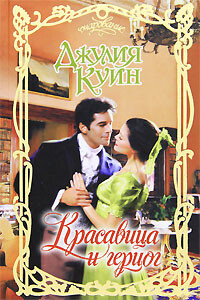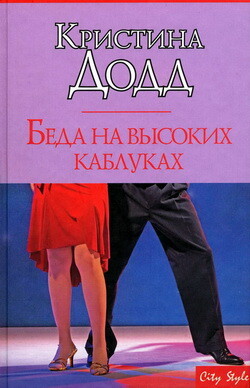Peter Wawerzinek - Rabenliebe

Помощь проекту
Rabenliebe читать книгу онлайн
Die Köchin heißt Frau Blume. Sie ist herzlich angetan und sieht nicht ein. Sie steckt hinter dem Plan, mich mit dem Mamapaket zu beschenken. Ich sitze am Fenster, an dem die Köchin vorbeimuss, will sie ins Heim, geht sie vom Kinderheim aus in den Ort hinein, einholen, kehrt sie mit vollen Netzen ins Haus zurück. Zweimal täglich ist sie im Wald unterwegs, morgens als Erste von ihrem Daheim aus, abends auf dem Nachhause. Wenn es im Winter noch düster ist, spätnachmittags, wenn es in der Winterjahreshälfte zu dämmern beginnt. Immer muss sie in den Wald hinein, sagt sie, in dem es dunkel ist, in dem die Äste knarren und ächzen, sich wie Gespenster benehmen. Im Winter, sagt sie, ist sie flinker daheim, wenn die Äste wie Peitschenhiebe knallen und sie vorantreiben. Ich sehe mich zu ihr in die Küche geladen, ihr behilflich zu werden, immer häufiger, bald täglich in ihre Küche beordert.
Ich nehme dich eines Tages mit, verspricht sie mehrmals. Ich sitze am Fenster. Ich schaue auf das Wäldchen, das zwischen den Stämmen seltsame Schatten wirft, vor denen es mich graust. Die Köchin schaut zu mir herauf, lächelt mir zu, winkt zu mir hin, wenn sie die Hand frei hat. Ich schmecke Salz auf meinen Lippen. Ich weiß nichts über die Herkunft des Salzes in der Luft. Ich weiß nichts vom Meer hinterm Wald und dem Salzgehalt des Meeres, das hinter der Baumreihe liegt, auf die ich blicke, wenn ich am Fenster bin. Ich habe das Meer auf meiner Zunge und kenne das Meer nicht. Zwischen mir und dem Meer ist der Waldstreifen. Ein tiefer Graben. Ich kann ihn nicht überwinden. Die Küche der Köchin Blume ist noch eine richtige Küche, mit Kacheln an der Wand, einer langen Arbeitsfläche aus Blech. Die Türen sind hell gestrichen, die Türenfenster in Glassegmente geteilt. Das Glas ist von Draht durchwoben und lässt an Bienenwaben denken, ein halbdurchlässiges Türscheibenglas, gegen das Besucher der Küche von außen mit den Schlüsselbunden klopfen. Ich erinnere den riesigen Fleischwolf, von dem gesagt worden ist, dass er, wenn man nicht darauf achtet, den Arm verschlingt, ihn in rosa Wurstschlangen verwandelt. Aus den Kachelwänden, in sie hinein, an den Wänden entlang, verlaufen verschiedene, offen zur Schau gestellte Rohre, wie in einem U-Boot. Die Wasserhähne glänzen golden, sind aus Messing. Die Rohre der Hähne ragen aus der Wand hervor, stehen gewichtig im Raum, rufen: Macht Platz da. Kellen, Töpfe, große Quirls hängen an Fleischerhaken auf hoher Stange. Die Köchin nimmt die Stange mit dem Piratenhaken, angelt den Topf vom Gestänge. Schubladen werden auf und zu bewegt. Hefekuchenteig wird unterm Leinentuch gehalten. Leinenstoff wölbt sich zum Hefebauch. Teig quillt über den Blechrand. Die Köchin ist dick. Ihr Leib steckt im Küchenkittel, unter ihm ist die Unterwäsche der Köchin derb und deutlich auszumachen. Das Haar trägt die Köchin unter einem festen Tuch zum Knoten gebunden. Ihre Finger glänzen wie Spiegeleihaut. Die Köchin arbeitet und nimmt Hilfe nur an, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Wenn Feiertage, große Feste anstehen, die Arbeit um ein Doppeltes, Dreifaches aufwendiger ist, können fremde Kräfte im Küchenreich Zuarbeiten ausführen. Ich will ihr eines Tages behilflich sein. Ich packe den Wischeimer mit schmutzigem Wischwasser gefüllt, der nicht leicht zu packen ist. Wasser schwappt. Der Eimer kippt. Ich rutsche auf der Pfütze aus, schlage lang hin, ramme mir die Henkelaufhängung des Eimerrandes durch die Unterlippe, säble zwei Milchzähne glatt weg, kann von innen her zwei Finger durch das Hautloch stecken, mit der Kuppe nach außen winken.
Die Köchin kommt gelaufen. Ich sehe sie an. Dann schwimmt sie hinfort. Ruhe kehrt ein. Stille ist, von der gesagt wird, dass man sie im Leben nur einmal vernimmt. Ich denke, ich bin tot. Ich komme wieder zu mir. Aus einer fernen Welt zurück sehe ich mich auf der Küchenbank, in stabiler Seitenlage. Die Köchin wendet mich wie einen Braten. Ich lande an ihrem Riesenbusen. Sie drückt mich fest an sich. Ich rieche ihr Fleisch. Ich rieche ihren Achselduft. So ein zartes Bürschchen aber auch, haucht die Köchin. Da wird eine Narbe bleiben, sagt der Doktor. Bis zur Hochzeit ist alles wieder gut, versichert die Köchin. Sie bedenkt mich mit Extraportionen. Eine Schublade mit Süßigkeiten, von der kein Kind im Heim etwas weiß, ist einzig für mich in der Küche eingerichtet. Aus ihr kann ich mich nach Herzenslust bedienen. Mutter Mutter es hungert mich gib mir Brot sonst sterb ich warte nur mein liebes Kind morgen wollen wir säen als es nun gesäet war sprach das Kind noch immerdar Mutter Mutter es hungert mich gib mir Brot sonst sterb ich warte nur mein liebes Kind morgen wollen wir schneiden als es nun geschnitten war sprach das Kind noch immerdar Mutter Mutt es hungert gib mir Brot sonst sterb ich warte nur mein liebes Kind morgen wollen wir dreschen als es nun gedroschen war sprach das Kind noch immerdar Mutter Mut es hungert gib sonst sterb warte nur, mein liebes Kind morgen wollen wir mahlen als es nun gemahlen war sprach das Kind Muttermut gib sonst warte nur mein liebes Kind morgen wollen wir backen als es nun gebacken war lag das Kind auf der Totenbahre.
DIE KÖCHIN STELLT eine Untertasse vor mich hin. Sie hebt ihre Augenbrauen, entnimmt dem Fach eine kleine Packung, öffnet die Packung und schüttet den Inhalt aus. Der Braunpulverberg ragt spitz auf in der Untertasse. Die Köchin nimmt Zucker zur Hand. Die Köchin bestreut den braunen Berg mit Zucker, schüttet mit dem Esslöffel Wasser über den Berg, mischt Zucker und Braunpulver zu einem bräunlich glänzenden Gemisch. Die dicke Köchin zwinkert mir wieder aufmunternd zu, der ich der traumhaft wirbelnden Köchin gegenübersitze, ihrem Treiben mit wachsendem Wohlgefallen zusehe. Sie singt ein Lied, das ich von der Sprache her nicht verstehe und doch recht gut erahne. Es handelt von einer Kuh, die Schokolade gibt. Und oben auf dem Berge steht die damische Kuh, macht das Auge mal auf und macht es dann wieder zu. Und die Kirche ist ein Wirtshaus. Und es regnet Leberkaas, schneit Bratwürschtl vom Himmel herab. Und unter den Leuten gibt es keinen Streit, weil alle zu jedermann nix reden und auch niemand je einem anderem zuhören mag und keiner von vielen im Einzelnen sagen will, was wer von einem gesehen hat, dass er es angestellt haben soll. Und nur gewiss ist, dass es im Dunklen finster ist und in der Finsterkeit der Blick nicht weiter geht als wie beim Tageslicht. Und am Ende vom Lied ist jedes Mal der Heuschreck vor dem Bauern gestanden und der hat ihm dann mit der Sense den Kopf abgemäht.
Ich bekomme den Esslöffel hingehalten. Ich öffne den Mund, schlecke das Braunzeug und verfalle in einen Hustenanfall, der mir die Atemluft nimmt, meinen Kopf puterrot werden lässt, dass die Köchin auf meinen Rücken einschlägt. Über die großen schwarzweißen Bodenkacheln tanzen Untertassen, Zuckerwürfel, Wasserglas und Esslöffel einen schwebenden Reigen. Ich werde aufs Zimmer gebracht. Ich ruhe aus und bin am nächsten Tag wieder am Küchentisch der Köchin. Ich soll die Augen schließen, den Finger in die von ihr gefertigte Masse stecken, den Finger ablecken, die Masse kosten. Ich zögere nicht. Ich schmecke Braunschneezucker, schmecke Süße, öffne die Augen. Die Köchin drückt mir den Löffel in die Hand, umschließt meine Faust zur Doppelfaust, führt den Löffel von der Untertasse meinem Munde zu, sagt: Für Mama von Mama. Jeder Widerstand löst sich in Wohlgefallen. Auf fliegt mir der Mund. Für Mama von Mama, schmeckt die Zunge. Löffel um Löffel schlecke ich Mamabrei. Herrliche Mamakristalle, ein Mamabreisee breitet sich auf der Untertasse vor mir aus. Für Mama von Mama, treibt die Köchin mich an, den Kau-kau vom Teller blank zu schlecken. Für Mama von Mama, bin ich folgsam, bis alles aufgeschleckt und sie mit mir zufrieden ist. Für Mama von Mama, lacht die Köchin. Für Mama von Mama, trällert die Köchin ihr selbst erfundenes Küchenlied. Für Mama von Mama, lobt sie mich, kneift mit ihren Fingerballen rechts links meine Wangen, um mich einen Wonneproppen zu rufen. Für Mama von Mama. Der Bäcker hat gerufen, wer will guten Kuchen backen, der muss haben sieben Sachen, Eier und Schmalz, Butter und Salz, Milch und Mehl, Safran macht den Kuchen gehl. Jederzeit darf ich zu ihr kommen, wann immer ich mag, Kau-kau verlangen, wenn mir nach Mama zumute ist. Sie zückt aus ihrer Kitteltasche einen Block, legt bunte Stifte hin, fordert mich auf, für Mama von Mama mit dem Schreiben zu beginnen. Ich soll an die Mama einen Dankesbrief schreiben. Schreib auf, was du fühlst. Und sind es nur Kritzeleien. Schreib alles nieder. Verschweige nichts. Das liebende Mutterherz wird die Schrift zu entziffern wissen. Und während ich überlege, was ich der Mutter zu schreiben habe, singt die Köchin über den Töpfen: Die Mutter möchte fein wissen, was eine Mutter ruhig wissen soll, nicht Honig ums Maul geschmiert bekommen will eine Mutter, in den Kummerpulverberg bohrt die Mutter das Loch, schüttet Herzenszucker hinein, gibt Tränenwasser hinzu, versüßt die Klage mütterlich, gütig dem Kinde.
ICH ZEICHNE EINEN VOGEL im Sturzflug. Ich zeichne das Aquarium, in ihm der Fisch, den ich neben der Meise und dem Zaunkönig als dritten Zeitvertreib mag. Ich zeichne einen Kau-kau-Berg, setze die Köchin daneben, skizziere den Löffel, die Zunge und einen schwarzen Käfer an eine Wolke geklammert, hinter der hervor die gelbe Sonne sieben Sonnenstrahlen über das Blatt Papier schickt. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonnabend, Sonntag, zählt die Köchin. Die ganze Woche Sonnenschein. Sie nimmt die Zeichnung an sich, klebt sie an die Kachelwand, wird immer und immer wieder darauf blicken, wie sie versichert, und betont, dass sie mit meiner Kunst für den Tag mehr als nur zufrieden ist. Zwei Briefe sind es, über ein Jahr verteilt, die mir die Köchin abgerungen hat. Die Mühle braucht Wind, Wind, Wind, sonst geht sie nicht geschwind, schwind, schwind, aus Korn wird Mehl, aus Mehl wird Brot und Brot tut allen Menschen not, drum braucht die Mühle Wind, Wind, Wind. Jeder einzelne Brief wird erwartungsvoll von mir an die Köchin abgegeben, die verspricht ihn einzustecken, abzusenden: Beide bleiben ohne Antwort.
Baby weggeworfen, Mutter in Psychiatrie. Die 29-jährige Frau wurde am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt und in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen, teilte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Michael Grunwald, mit. Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll die 29-Jährige den zwei Monate alten Säugling in der Nacht zum Donnerstag im Zustand zumindest verminderter Schuldfähigkeit vom Balkon geworfen haben. Gegen die Frau wird wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Totschlags ermittelt. Die Mutter selbst beschrieb den Vorfall in der richterlichen Vernehmung als einen Unfall. Das Baby war auf einem Vordach gelandet. Bei dem Sturz erlitt das Kind ein schweres Hirn-Trauma. Das Mädchen wird auf der Intensivstation der Charite behandelt.
DIE HÄNDE VOR DER KÜCHENSCHÜRZE gefaltet, in sichtliche Erregung gehüllt, spricht sie eines anderen Tages in einem ungewohnten feierlichen Ton: Heut nehme ich dich mit. Heut kriegst du das Meer zu sehen. Lirum, laram, Löffelstiel, alte Weiber essen viel, junge müssen fasten, 's Brot liegt im Kasten, 's Messer liegt daneben, ei welch ein lustig Leben, lirum, larum, Löffelstiel, wer nichts lernt, der kann nicht viel, reiche Leute essen Speck, arme Leute habn Dreck, ich bring dich heute von hier weg, lirum, larum, Leier, die Butter ist nicht zu teuer. Die Köchin kleidet mich an und eilt mit mir an der Hand durch den Gespensterwald. Wind stößt uns voran. Zwischen den Bäumen entlang des Weges sehe ich das Meer streifenweise bläulich, dunkel, halte das Meer noch für den Himmel. Das alles schauen wir uns morgen bei Tageslicht richtig an, sagt die Köchin, zieht mich vorwärts. Der dunkle Himmel rauscht. Sand fliegt durch die Luft. Sand verfängt sich zwischen meinen Zähnen. Dann sind wir angelangt, bei der Köchin zu Hause.
An dieser Stelle muss ich einflechten, dass ich zu jener Zeit der Erfüllung eines Lebenswunschs nahe stand. Der kurze Spaziergang war für mich wie eine Reise nach Afrika. Stellt man sich eine Sache vor, die weitab vom gewöhnlichen Denken liegt, so hegt man keinerlei Zweifel an ihrer Erfüllung. Sie stellt mich vor die Tür, geht zu ihrem Mann in die gute Wohnstube, wo sich die folgende Szenerie entwickelt. Wen, sagst du, hast du heute mitgebracht, fragt der Mann der Köchin. Einen Jungen vom Heim. Was für einen Jungen? Einen Kinderheimjungen halt. Nicht wirklich? Doch. Nein. Doch. Nicht doch. Schau ihn dir an.
Die Köchin schiebt mich ins Wohnzimmer. Nun sieh schon. Der Mann guckt von hinter seiner Zeitung nicht hervor. Der Kopf kommt nicht über den Rand seiner Zeitung. Die Zeitung fragt die Köchin: Was ist mit dem Kind? Es will uns kennenlernen. Es wird auf Probe bei uns wohnen. Die Köchin putzt mit dem Ärmel meine Wangen, die wie Äpfelchen zu ihren Werbeworten glänzen. Sie schubst mich der Zeitung zu. Der Busfahrer legt die Zeitung ab. Ich erinnere ihn im löchrigen Unterhemd. Sommersprossen und Haarflaum erinnere ich über die Brust hinweg ums Unterhemd herum, in es hineinkriechend. Der Mann legt die kräftigen Unterarme auf die Tischplatte. Dickliche Hände liegen vor mir aus, von Sommersprossen übersät, von einem rötlichen Flaum überdeckt. Werktags, sagt der Mann, der als Busfahrer tätig ist, bin ich mit dem Bus unterwegs. Früh gehe ich aus dem Haus, erledige Schulbusfahrten, für kleine Passagiere, die ein Pack sind, eine Rasselbande von lauter Nervzwergen. Hinter mir ist es laut. Kinder toben, dass ich ein um das andere Mal den Bus zu stoppen mich gezwungen sehe, um Standpauken abzuhalten, was wenig nützt bei unerzogenen Kindern, die mit jedem Jahr wilder sind, weil keine Zucht herrscht und nicht Ordnung, die edlen Werte längst flöten gegangen sind in diesem Land. Von der Arbeit erschöpft, durch das Krawallen erledigt, ruhe ich am liebsten in meinem Haussessel aus. Die Füße auf dieses Kissen gelegt, möchte ich in Stille meine Zeitung lesen, wenn mir nach Ruhe ist und Zeitunglesen. Ich will nicht daheim zusätzlich von einem Kind heimgesucht sein.
Hat es gesprochen. Nimmt die Zeitung wieder auf. Bedeckt seinen Unmut mit Zeitungspapier. Die Köchin sieht das anders. Die Köchin wirkt entschlossen. Sie bietet dem Mann ihre Stirn. Was ein erfolgreiches Adoptionsunterfangen werden sollte, nimmt verdrießliche Züge an. Diese Nacht bleibt er, Männl, sagt die Köchin. Nichts da, tönt es von hinter der Zeitung her. Diese eine Nacht. Alle folgenden Nachnächte auch. Nicht eine. Wir werden ja sehen. Nichts da sehen. Du schaffst mir den Jungen zurück ins Heim, sagt die Zeitung, unternimmt aber nichts, sondern steht weiterhin schützend zwischen dem Mann und seiner Köchin, die heftiger wird, die Zeitung angeifert: Nur über meine Leiche. Augenblicklich, sag ich, sagt der Mann, schmettert die Zeitung energisch zurück. Montag, mit der Arbeit bring ich ihn zurück. Jetzt sofort, sage ich. Das Kind bleibt. Ohne mich, tönt der Mann, knüllt das Tagesblatt, erhebt sich, schaut wütend und entschlossen aus, geht zum Zimmer hinaus. Die Köchin triumphiert. Ich darf vorerst bleiben. Der gewöhnt sich mit der Zeit, sagt sie. Der wird bald einen Gefallen an dir entwickeln. Niemals und basta damit, ruft der Mann vom Flur her. Die Köchin geifert ohrenbetäubend: Was du nur für ein Sturkopf bist. Die resolute Köchin geht mit mir an ihrem bockigen Mann vorbei, bringt mich und sich in die Sicherheit ihrer häuslichen Küche, in ihre private Bündigkeit, um mit Inbrunst zu schluchzen, wobei sie umherläuft, die mitgeführten Nachtkleidungsstücke auspackt. Dann lässt sie mich Pellkartoffeln enthäuten, die nackten Kartoffeln in Scheiben schneiden. Sie packt mich in aufwallender Aufgebrachtheit, herzt und umarmt mich, erdrückt mich schier, wendet sich ab, um die von mir geschnittenen Kartoffelscheiben in Butter zu braten, mit extra kräftigem Magerspeck, hauchdünnen Zwiebelstücken versehen. Von den Eiern nehme ich nur das Gelbe, sagt sie erholt, in froher Zuversicht. Das Ganze würze ich mit Paprikapulver. Den Pfeffer mahle ich in diesem Mörser hier. Und so streue ich die fein gehackte Petersilie über die Zwiebelringe. Nun nur noch rasch ein Senfhäuflein obenauf, alles schön auf einem Teller arrangiert. Wäre doch gelacht, wenn wir das Männl nicht umzustimmen wüssten. Der ist, wie er ist, sagt sie mit dem Tablett in der Tür zu mir. Der ist kein Schlechter. Den muss man zu nehmen wissen. Sie bringt ihm das Essen aufs Zimmer. Es folgt ein Wortsturm. Es geht hin und her. Laut wird es. Besteck klirrt. Die Tür wird zugeschlagen. Die Versöhnung misslingt. Der Busfahrer schnieft, die Köchin ist zurück in der Küche, will mit ihrem Männl nichts mehr zu schaffen haben, packt die Nachtsachen zurück in die Tasche, verflucht den Mann, bringt mich zu Bett. Weckt mich am nächsten Morgen, führt mich durch den Wald ins Heim zurück. Meine Hand wie in Gewahrsam, die vom Handdruck schmerzt, eilt die Köchin durch die Dunkelheit, dass der Wind um uns aufhört zu wehen, es still ist um uns und dunkel wie nie zuvor in meinem Leben. Und doch behielt ich frischen Mut, wie stets ein rechter Bursch es thut, weil ja das herbe Scheiden muss jeder einmal leiden, erst als ich eine sah, so blass und ihre blauen Äuglein nass, die lieben wohlbekannten, da ging mein Mut zu Schanden, ich zog betrübt zum Tor hinaus und wischte manche Träne aus, hab tausendmal im Gehen mich zu dem Häuschen umgesehen. Die Köchin bei der Hand, bin ich blind, sehe keinen Baum vor lauter Bäumen. Die Köchin orientiert sich am Himmel, wo die Baumkronen sich schwach vom Nachthimmel abheben. Sie sieht nach oben, woher ihr keine Hilfe kommt. Ich blicke zu Boden, wo der Waldboden unsichtbar ausliegt, lasse mich von der Köchin ins Kinderheim ziehen, sehe mich in die Gemeinschaft der Kinder zurückgebracht, mag Busfahrer nicht und werde im Traum des Öfteren von einem Bösewicht heimgesucht.